 Je länger der Zweite Weltkrieg dauerte, um so stärker wurden in
Deutschland die Folgen eines gravierenden Arbeitskräftemangels
spürbar. Immer mehr Männer wurden zum Militärdienst eingezogen,
und gleichzeitig schnellten die Verlustzahlen der deutschen Truppen und auch
der Zivilbevölkerung in die Höhe. Die nationalsozialistische
Kriegsmaschinerie drohte lahmzuliegen. Ein Mittel, um den bevorstehenden
Kollaps hinauszuzögern, war neben der verstärkten Heranziehung von
Frauen zu oft schwerer Arbeit der massenhafte Einsatz von Zwangsarbeitern.
Unter dieser Bezeichnung werden heute verschiedene Personengruppen
zusammengefasst, die damals von den Nationalsozialisten aus unterschiedlichen
Gründen - als Ostarbeiter, Fremdarbeiter, Kriegsgefangene u.a. - nach
Deutschland verschleppt und hier zur Arbeit gezwungen wurden.
Je länger der Zweite Weltkrieg dauerte, um so stärker wurden in
Deutschland die Folgen eines gravierenden Arbeitskräftemangels
spürbar. Immer mehr Männer wurden zum Militärdienst eingezogen,
und gleichzeitig schnellten die Verlustzahlen der deutschen Truppen und auch
der Zivilbevölkerung in die Höhe. Die nationalsozialistische
Kriegsmaschinerie drohte lahmzuliegen. Ein Mittel, um den bevorstehenden
Kollaps hinauszuzögern, war neben der verstärkten Heranziehung von
Frauen zu oft schwerer Arbeit der massenhafte Einsatz von Zwangsarbeitern.
Unter dieser Bezeichnung werden heute verschiedene Personengruppen
zusammengefasst, die damals von den Nationalsozialisten aus unterschiedlichen
Gründen - als Ostarbeiter, Fremdarbeiter, Kriegsgefangene u.a. - nach
Deutschland verschleppt und hier zur Arbeit gezwungen wurden.
Auch in Göttingen beschäftigten die meisten Unternehmen ebenso wie
Stadtverwaltung, Reichsbahn und Universität in großem Maßstab
Zwangsarbeiter, um ihre Produktion aufrecht zu erhalten und ihre Aufgaben
erfüllen zu können.
 Aber auch in zahlreichen Privathaushalten und
nicht zuletzt bei den Bauern der umliegenden Ortschaften mussten diese Menschen
arbeiten. Ihre genaue Zahl lässt sich bisher nur grob schätzen. 1944
waren es ca. 3.000 Männer, Frauen und auch Kinder, was immerhin etwa sechs
Prozent der damaligen Einwohnerschaft entspricht. Die meisten waren in Lagern
- 1944 gab es davon mindestens zwanzig - untergebracht, die über das
gesamte Stadtgebiet verteilt waren. Die größten davon befanden sich
auf dem Schützenplatz, an der Masch, auf der Eiswiese und an der Tonkuhle,
wo jeweils Hunderte von Menschen lebten. Es gab aber auch kleine
Sammelunterkünfte, die mit nur wenigen Personen belegt waren.
Aber auch in zahlreichen Privathaushalten und
nicht zuletzt bei den Bauern der umliegenden Ortschaften mussten diese Menschen
arbeiten. Ihre genaue Zahl lässt sich bisher nur grob schätzen. 1944
waren es ca. 3.000 Männer, Frauen und auch Kinder, was immerhin etwa sechs
Prozent der damaligen Einwohnerschaft entspricht. Die meisten waren in Lagern
- 1944 gab es davon mindestens zwanzig - untergebracht, die über das
gesamte Stadtgebiet verteilt waren. Die größten davon befanden sich
auf dem Schützenplatz, an der Masch, auf der Eiswiese und an der Tonkuhle,
wo jeweils Hunderte von Menschen lebten. Es gab aber auch kleine
Sammelunterkünfte, die mit nur wenigen Personen belegt waren.
Die Existenz der Zwangsarbeiter war kein Geheimnis, sie waren im Straßenbild vielfältig gegenwärtig. Morgens wurden sie in geschlossenen Kolonnen oder Gruppen zur Arbeit geführt und sie konnten sich außerdem bis zu einem gewissen Grade in der Stadt frei bewegen. Viele ältere Göttinger werden sich noch an die zerlumpten, um Nahrung bettelnden Jammergestalten erinnern.
Zwangsarbeiter mussten in der Regel "einfache" Arbeiten - bei der Müllabfuhr, auf dem Bauhof, in Kantinen und Küchen - verrichten. Höherwertige Tätigkeiten wurden ihnen schon aus - durchaus begründeter - Angst vor Sabotage nicht übertragen. Allerdings waren sie als Arbeitskräfte begehrt und mussten beim Arbeitsamt speziell angefordert werden, ihre Unterbringung und Verpflegung dagegen stand weitgehend im Ermessen der Arbeitgeber.
Damit hing es zusammen, dass die Lebens- und Arbeitsverhältnisse dieser
Menschen sehr unterschiedlich waren. Das vielfach gehürte Argument
"Denen ging es ja gar nicht so schlecht!" geht aber grundsätzlich
in die Irre.
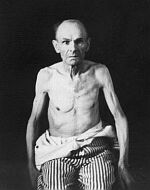 Gegenüber den Millionen, die von den Nationalsozialisten
systematisch ermordeten wurden, mögen sie "Glück" gehabt
haben. Aber schon allein die Tatsache, dass sie hier zur Arbeiten gezwungen
wurden, war schreiendes Unrecht, und verglichen mit ihren deutschen Kollegen
war ihre Lage erbärmlich. Die Entlohnung - wenn überhaupt ausgezahlt
- war lächerlich gering, die Unterbringung in den Lagern häufig
katastrophal, die Ernährung miserabel und die Sterblichkeit hoch: allein
auf dem Göttinger Stadtfriedhof sind über 460 Bestattungen von
Zwangsarbeitern nachgewiesen. Das hinter dieser Zahl stehende Elend wird erst
dann richtig deutlich, wenn man sieht, dass die meisten der Verstorbenen im
"besten" Alter zwischen zwanzig und fünfzig standen. Aber auch
Kinder gehörten zu den Opfern: Nikolou Boriskow war dreizehn, Dmitri
Roschaltschenko elf, Dmitrij Kanigin und Nonna Jaworonka erst fünf bzw.
drei Monate alt, als sie in Göttingen starben.
Gegenüber den Millionen, die von den Nationalsozialisten
systematisch ermordeten wurden, mögen sie "Glück" gehabt
haben. Aber schon allein die Tatsache, dass sie hier zur Arbeiten gezwungen
wurden, war schreiendes Unrecht, und verglichen mit ihren deutschen Kollegen
war ihre Lage erbärmlich. Die Entlohnung - wenn überhaupt ausgezahlt
- war lächerlich gering, die Unterbringung in den Lagern häufig
katastrophal, die Ernährung miserabel und die Sterblichkeit hoch: allein
auf dem Göttinger Stadtfriedhof sind über 460 Bestattungen von
Zwangsarbeitern nachgewiesen. Das hinter dieser Zahl stehende Elend wird erst
dann richtig deutlich, wenn man sieht, dass die meisten der Verstorbenen im
"besten" Alter zwischen zwanzig und fünfzig standen. Aber auch
Kinder gehörten zu den Opfern: Nikolou Boriskow war dreizehn, Dmitri
Roschaltschenko elf, Dmitrij Kanigin und Nonna Jaworonka erst fünf bzw.
drei Monate alt, als sie in Göttingen starben.